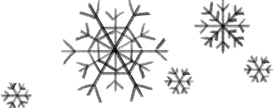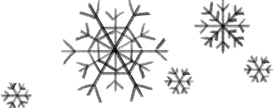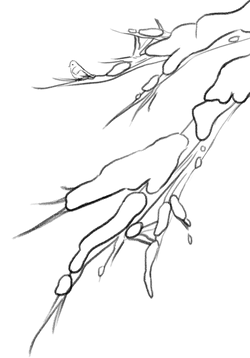
»Wissen Sie, was ich getan habe?«
»Ja, das weiß ich.«
»Wirklich?«
»Wirklich.«
Sie wissen gar nichts, will ich ihm vorwerfen, aber das wäre ungerecht. An seiner Unwissenheit bin ich schuld. Ich mache es ihm nicht leicht. Verberge mein Inneres und verschließe mein Herz vor einem möglichen Urteil. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt einen Sinn ergibt. Wie ich all meine falschen Entscheidungen richtigstellen kann.
Mein Gegenüber beobachtet mich. Still und abwägend.
»Sie wirken nicht, als ob Sie Mitleid mit mir hätten.«
»Warum sollte ich Mitleid haben?«, wirft er mir die Frage ohne jegliches Feuer entgegen. »Für die Dinge, die du getan hast, bist du allein verantwortlich. Ich leugne nicht, dass dein Umfeld für deine Entwicklung eine zentrale Rolle gespielt hat, aber du bist erwachsen genug, um zu begreifen, was richtig und was falsch ist.«
Ich rutsche auf dem schwarzen Ledersessel herum und suche nach einer gemütlichen Position. Probeweise werfe ich meine Beine über die Armlehne. Wirklich bequemer ist das nicht.
»Was soll das werden, Ryan?«
»Schon mal darüber nachgedacht in eine Couch zu investieren?«, frage ich und sehe ihn missmutig an.
Müde reibt er sich den Nasenrücken. »Können wir einfach weitermachen?«
»Nichts da! Ich kann Ihnen beim nächsten Mal Empfehlungen mitbringen. Jeder Psychologe braucht eine echte Ledercouch. Gehört zum Standard-Inventar.«
»So wie du?«
Ich muss lachen. »Der Punkt geht an Sie, Doc.«
Seufzend setze ich mich richtig in den Sessel. Dr. Thomson ist mir von der Mutter eines Freundes empfohlen worden. Er ist ein hochgewachsener Mann um die Fünfzig in einem lässigen weißen Hemd, brauner Stoffhose und Lederschuhen. Auf verwegene Weise ist er gutaussehend. Für sein Alter hat er sich jung gehalten, mit Lachfältchen im Gesicht und einem gepflegten Dreitagebart.
Seit ein paar Wochen besuche ich regelmäßig seine kleine Privatpraxis. Sie befindet sich direkt in der Innenstadt zwischen dem Einkaufszentrum und einer schicken Bankfiliale. Die Parkbuchten sind zu jeder Tageszeit belegt. Aus diesem Grund habe ich es mir angewöhnt, zu laufen. Am liebsten würde ich gar nicht kommen, doch es war eine Bedingung von Jensen. Eine letzte Chance, mein Leben in den Griff zu kriegen.
In den Köpfen der Bewohner dieser Drecksstadt gehöre ich zu der Sorte von Menschen, die ein paar Mal falsch abgebogen sind. Zerrüttetes Familienleben, Kontakt mit Drogen, die zu wilden Partys und heftigen körperlichen Auseinandersetzungen führten. Dass ich obendrauf in einem Nachtclub gearbeitet habe und mir als Rapper einen Namen machte, schien die Gerüchteküche nur weiter anzustacheln. Ein Klischee reihte sich an dem nächsten und schnell wurde ich in die passende Schublade gesteckt. Meine heißt: Deine Mutter würde sich schämen, wenn sie dich so sehen müsste.
Interessiert es mich, was andere von mir halten?
Nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, da wollte ich von ihnen anerkannt werden. Sie sollten bemerken, wie sehr ich mich bemühte, ein anständiges Leben zu führen. Stattdessen wurden meine Taten verurteilt. Niemand wollte erkennen, dass ich nur Gutes im Sinn hatte.
Interessiert es mich, was meine Freunde über mich denken?
Scheiße, ja. Was werden sie wohl sagen, wenn sie meinen Namen hören? Werden sie enttäuscht sein? Wütend? Niedergeschlagen? Fuck. Darüber will ich nicht nachdenken.
Ich blicke auf.
Dr. Thomson rührt seelenruhig den Löffel in seiner Tasse. Viel Milch und vier Zuckerwürfel. Kein Plan, weshalb der Mann überhaupt Kaffee trinkt mit seiner Vorliebe für Süßes. Genauso frage ich mich, warum ich mir das hier antue. Mein Onkel Marcus ist der Einzige gewesen, der von Jensens Forderung begeistert war.
Da kannst du dir alles von der Seele reden. Es wird dir guttun, hatte er mit einem fetten Grinsen gemeint.
Guttun, huh?
Das bezweifle ich seit der ersten Sekunde, aber nach meiner Meinung wird nicht gefragt.
»Wo waren wir stehen geblieben?«, unterbricht Dr. Thomson meine Gedanken, nachdem er seine Tasse auf dem Beistelltisch abgestellt und seinen Block in die Hand genommen hat.
»Dass Sie kein Mitleid haben.«
»Nein.«
»Bei der Tatsache, dass Ihnen eine Couch fehlt?«
»Auch nicht.«
Ich werfe die Hände hoch. »Dann habe ich absolut keine Ahnung.«
»Gut«, meint er und lehnt sich zurück. »Lass uns über ein anderes Thema sprechen.«
»Solange ich keine abstrakten Zeichnungen deuten soll, die Auskünfte über mein tiefstes Inneres widerspiegeln sollen, bin ich offen für Vorschläge.«
»Nein, keine Sorge«, meint er angesäuert und schreibt etwas nieder. »Ich lerne aus meinen Fehlern.«
»Haben Ihnen meine Interpretationen nicht gefallen?«, frage ich unschuldig.
Kurz huscht ein tadelnder Blick in meine Richtung, bevor er sich wieder seinem Block widmet. »Mich hat deine Einstellung gestört. Du hast die Sache nicht ernst genommen.«
»Das verletzt mich, Doc.«
Das Spielchen Ich-zeig-dir-ein-Bild-und-du-sagst-mir-was-du-siehst haben wir in meiner zweiten Sitzung gespielt. Dr. Thomson schien hohe Erwartungen in diese hässlichen Tintenklecksbildern zu haben. Desinteressiert gab ich ihm bei jedem Bild die gleiche Antwort: Ein Haufen wahlloser Pinselstriche, die jeder Dreijährige besser hinbekommen würde.
Man kann mir vieles vorwerfen. Ich sei kindisch, nicht bei der Sache, hätte eine abwehrende Haltung. Im Nachhinein weiß ich selbst nicht, warum ich das gesagt habe. Ich habe wohl einfach gehofft, dass ich den guten Herrn Doktor mit meiner Aussage provozieren könnte.
Mein Versuch war gnadenlos gescheitert.
Dr. Thomson war weder schockiert, noch beklagte er sich über mein trotziges Verhalten. Stumm notierte er seine Beobachtungen und seitdem verschont er mich mit ähnlichen psychologischen Spielchen.
In unseren Therapiesitzungen reden wir hauptsächlich über mich. Einmal habe ich ihn gefragt, ob es Colin besser ginge, nach allem, was passiert ist. Neugierig wollte er wissen, wieso es mich interessierte.
Da gibt es mehrere Gründe.
Colin ist ein Freund von mir.
Er ist auch ein Freund von meinem Bruder. Nein … Das ist so nicht ganz richtig. Die Beziehung der beiden ist weitaus mehr. Ein Umstand, der mir erst vor ein paar Wochen bewusst wurde.
Wenn du wissen willst, wie es deinem Freund geht, dann sprich mit ihm, erinnere ich mich an seine Antwort.
Als ob das so leicht wäre. Reden. In alte Muster zurückfallen. Da ist eine unüberwindbare Mauer, die mich davon abhält. Ich kann nicht einfach so tun, als wären die letzten Monate nicht passiert. Mein Doktor zwingt mich, den Mund aufzumachen und über meine Gefühlswelt zu plaudern, aber er gibt mir keine brauchbaren Tipps, wie ich mich meinen Freunden gegenüber verhalten soll.
Gutgemeinte Ratschläge nützen nichts, wenn man nicht bereit ist, diese anzunehmen. Bis heute frage ich mich, was er damit gemeint hat …
»Du warst doch ein erfolgreicher Rapper mit zahlreichen Auftritten.«
»Ich bin es noch immer«, korrigiere ich ihn.
»Dir ist klar, dass du beurlaubt wurdest«, meint Dr. Thomson ruhig. »Auf unbestimmte Zeit.«
Die Art und Weise, wie er dies sagt, kotzt mich an.
»Ja, verdammt.« Kampfeslustig begegne ich seinem prüfenden Blick. »Kein Grund, Salz in die Wunde zu schütten. Mir ist bewusst, was ich verloren habe.«
»Was denkst du, hast du verloren?«, fragt er unbewegt. »Ruhm? Ansehen? Deinen Traum?«
»Warum stellen Sie mir diese dämlichen Fragen?«
Sein Kinn spannt sich an. »Warum weichst du mir aus? Wovor hast du –«
»Gott, wenn Sie mich jetzt ernsthaft fragen, wovor ich Angst habe, raste ich aus.«
»Tust du das nicht schon?«, fragt er sanft und der Ausdruck, der über mein Gesicht fliegt, muss mörderisch sein, denn er hebt eine Hand zu einer beschwichtigenden Geste. »Ich weiß, dass deine Situation nicht leicht zu verarbeiten ist. Es wirkt, als ob alles auseinanderbricht und du unfähig bist, an dem Zustand etwas zu ändern. Aber das stimmt nicht. Sieh es als eine Art Pause und nicht als Verlust.«
»Als Pause?« Jetzt muss ich lachen. Es klingt fremd. Irgendwie bitter. Rauer. Ich habe Mühe, mich zu beherrschen. »Haben Sie eigentlich die geringste Ahnung davon, was für einen scheiß Müll Sie gerade labern? Für Sie scheint es so verdammt einfach zu sein. Runterschlucken und weitermachen, was?!«
Dr. Thomson holt tief Luft. Sein Ton schwankt zwischen Verärgerung und Enttäuschung. »Nach all der Zeit hast du es immer noch nicht begriffen.«
»Dann erleuchten Sie mich!«, spucke ich aus.
»Nein.«
Reizt er mich absichtlich? Meine Finger krallen sich in die Armlehne, als ich mir meine Faust in seinem Gesicht vorstelle. Ob Jensen mir das verzeihen würde?
»Erinnerst du dich an unsere erste Sitzung?«, fragt Dr. Thomson. »Ich habe dir versprochen, dass ich dir helfen werde.« Es kommt gleich ein ›Aber‹, das weiß ich genau. Er macht sein Aber-Gesicht, welches ich schon zu oft bei ihm gesehen habe.
»Aber«, setzt er fort und ich schnaube. »Die Antworten, die du suchst, musst du allein finden.«
»Das ist Bullshit!«
»Hast du dir schon einmal die Mühe gemacht, deine eigenen Verhaltensmuster kritisch zu hinterfragen? Ich höre von dir, dass du die Zeiten vermisst, aber gleichzeitig hast du mir in einer anderen Sitzung gesagt, dass Ruhm mit einem Preis kommt.« Er macht eine gekünstelte Pause. »Also, was ist dein Opfer, welches du bereitwillig in Kauf genommen hast?«
Darauf finde ich keine schlaue Antwort und ich merke, wie mein Kopf sich hilfesuchend den Zeigern meiner Uhr widmet.
»Willst du wieder flüchten?« Eine rhetorische Frage, die mich vermutlich nur weiter provozieren soll.
»Unsere Zeit ist um«, sage ich plump.
Sein Blick gleitet zur großen Standuhr, die neben einem prallgefühlten Bücherregal steht.
Dr. Thomson seufzt. »Ich will, dass du mir beim nächsten Mal eine Antwort gibst. Bis dahin schreib auf, was in dir vorgeht. Was empfindest du, wenn du dich im Spiegel siehst? Welche Gedanken halten dich wach?«
»Um mir zu helfen?«
Seine Mundwinkel zucken. »Denkst du, wir sehen uns, weil mich deine Gesellschaft erfreut?«
»Das ist hart, Doc«, tue ich gespielt verletzt und stehe auf.
Das Problem einer Kleinstadt ist, dass Neuigkeiten sich wie ein elendes Lauffeuer verbreiten. Geschichten werden weitergetragen. In den unterschiedlichsten Variationen. Die Menschen reden. Jeder liebt eine gute Story und unsere Stadt ist voll davon. Über das verbrannte Herrenhaus im Reservat, die tragischen Verluste, die Kids auf den alten Bahngleisen, die Trinksucht meines Vaters. Auch über mich zerreißen sie ihre Mäuler.
Hast du gewusst, dass er bis vor Kurzem in einem Wohnwagen gelebt hat?
Bin froh, dass Marcus hier ist. Die Familie braucht jetzt jede Unterstützung.
Jemand sollte mit ihm reden.
Er will nicht reden. Hast du mitbekommen, dass er nur selten seine Wohnung verlässt?
Hab gehört, er soll Drogen nehmen.
Ernsthaft? Ich habe gewusst, dass der Junge komisch drauf ist. Kinder in einem unsicheren Umfeld neigen oft zu Ausbrüchen.
Ryan tut mir leid. In seinen jungen Jahren hat er bereits so viel verloren.
Vielleicht ist er depressiv?
Meinst du, er wird –
Unsinn! Er würde niemals das Gleiche tun.
Seit sein Bruder –
Pssst. Red nicht darüber!
Aber es stimmt. Seitdem er nicht mehr mit seinen Freunden rumhängt, ist er nicht mehr derselbe.
Seine Freunde? Meinst du nicht eher dieses Mädel, mit der er immer unterwegs war?
Welches Mädel?
Ach, du weißt es nicht? Sie hat die Stadt verlassen und seit diesem Tag verhält er sich seltsam.
Scheiß-Bewohner und ihre Scheiß-Vorliebe für den neuesten Klatsch und Tratsch. Sie werden ausgetauscht, zerrissen und getragen wie alte Baseballkarten. Einige sind wertvoll, manche sind rein gar nichts wert. Die Menschen denken, dass sie schlau sind, aber ich höre es. Ich weiß, was sie hinter meinem Rücken tuscheln. Ich kenne alle Geschichten und ich weiß auch, welche von ihnen wahr sind.
Es ist wahr: Meine Mom ist plötzlich gestorben und mein Vater hatte nichts Besseres im Sinn, als seinen Kummer in Alkohol zu ertränken. Er verspielte sämtliche Rücklagen bei sinnlosen Wetteinsätzen und gab einen Dreck um seine Kinder. Das war einer der Gründe, weswegen ich im Wohnwagen meines Onkels lebte. Er gab mir Zuflucht von den ständigen Streitereien zu Hause. Doch am Ende kommt es mir so vor, als sei ich einfach davongelaufen. Ich ließ meine Schwester und meinen jüngeren Bruder bei meinem Vater, weil ich das Ausmaß seiner Ausbrüche nicht gesehen habe.
Nicht wahr: Ich verlasse meine Wohnung nicht. Ich tue es. Allerdings erst in den späten Abendstunden rutsche ich von der Eingangstür zum blauen Jeep und fahre los. In den Wald, zum alten Herrenhaus, zum Friedhof zu einer Grabstätte, ins Krankenhaus zu einem viel zu stillen Zimmer.
Stimmt: Ich meide Menschen. Ich habe nicht viel für sie übrig. Zumindest für diejenigen, die glauben, mir helfen zu müssen. Ich brauche ihr gespieltes Mitleid nicht. Aus diesem Grund vermeide ich es auch, mit ihnen zu reden. Ich weiß, was es bedeutet, allein zu sein. Ich habe nur wenige Personen, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Dazu gehören meine Schwester Olivia und mein Bruder Philip. Genauso meine Freunde. Evan, Edward, Adam, Nick und Colin.
Teils wahr: Ich bin nicht auf Drogen, obwohl ich das Gefühl vermisse. Etwas zum Einschlafen vielleicht. Etwas gegen den drückenden Schmerz in meiner Brust. Etwas, um für wenige Stunden alles zu vergessen. Ja, ich habe Drogen genommen, aber jetzt nicht mehr. Ich verkaufe sie auch nicht. Das habe ich nie.
Eine Lüge: Nur weil das Leben einen in den Arsch tritt und sich in der Familie einige Probleme stapeln, neigt man nicht zu Ausbrüchen. Adams Eltern haben sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Vertrauensbruch. Sie haben versucht, wieder zueinanderzufinden, doch letztlich war ihre Liebe nicht stark genug. Zu viel Misstrauen und zu viele Geheimnisse verträgt keine Beziehung. Ich sage nicht, dass Adam das Ganze freudestrahlend wegsteckte, aber der Junge hat keinen Hang zu Gewalt oder sonstigen kriminellen Handlungen. Verflucht! Adam ist so unschuldig, wie man eben nur sein kann. Wäre die Sache auf Coras Party nicht gewesen, hätte er noch nie Kontakt mit irgendwelchen Drogen gehabt. Eine Sache, die ich mir bis heute nicht verzeihen kann.
Ganz offenbar, unglaublich und völlig falsch: Ich bin nicht depressiv. Ja, ich bin nicht mehr derselbe unreife Junge, der nur Unfug im Kopf hatte, aber das hat absolut nichts mit einem verdammten Mädchen zu tun. Rein gar nichts!
Aus all den Unwahrheiten, die über mich geflüstert werden, ist das diejenige, die mich am meisten verärgert.
Manchmal, wenn man es am wenigsten vermutet, wird man einen Ort finden und neue Dinge erfahren. Über die Menschen, deren Beziehungen untereinander und über einen selbst.
Ich habe es erlebt. Als ich mir die Zeilen deines Briefes auf einer verlassenen Parkbank durchgelesen habe, wusste ich sofort, welcher Ort gemeint ist.
Ein perfekter Platz der Ruhe, an dem ich lange Stunden verbringen kann. Tu mir den Gefallen und besuch das Café. Dort gibt es den besten Käsekuchen der Stadt und die leckerste Heiße Schokolade, die ich jemals getrunken habe.
Ich stoße die Tür auf und das kleine Glöckchen kündigt meine Ankunft an. Warme Luft schlägt mir ins Gesicht. Ein paar Gäste drehen sich grimmig zu mir um, weil ich die Kälte hereinlasse. Ich schlüpfe hinein und finde meinen üblichen Sitzplatz an der Fensterfront.
Die Kellnerin unterbricht ihre Unterhaltung mit einem älteren Pärchen und lächelt mir freundlich zu. Auch ich kann mir ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Vermutlich wirkt es mehr gezwungen, doch zu mehr fühle ich mich derzeit nicht im Stande. Sie nimmt es mir nicht übel. Das tut sie nie. Casey ist die einzige Person, die mir keine Gespräche aufbürdet. Vielleicht bin ich deswegen gern hier.
Das Café ist gemütlicher, als es zuerst den Eindruck macht. Die Möbel sind dunkel gehalten und das Licht der tiefhängenden Lampions ist angenehm gedimmt. Es untermauert die ruhige Atmosphäre. Nur die roten Dekokissen, die auf jedem Stuhl liegen, nerven mich. Jedes Mal werfe ich mein Kissen auf eine andere Sitzbank, aber sobald ich wiederkomme, starre ich auf das grässliche Stück Stoff, welches mich triumphierend zu belächeln scheint.
Während ich warte, beobachte ich Casey, wie sie mit Kaffee und Kuchen zu dem Paar in der Nische auf der anderen Seite des Cafés hinübergeht und mit den beiden das Gespräch fortführt. Worüber sie sich auch unterhalten, es muss etwas Angenehmes sein, denn alle drei tragen ein herzhaftes Lächeln im Gesicht.
Soweit mir bekannt ist, arbeitet Casey in dem Café ihrer Eltern, um sich ihr Studium zu finanzieren. Sie ist methodisch, ehrgeizig und ziemlich direkt. Ihre aufblühende Art hat etwas Erfrischendes, was bei den Gästen gut ankommt. Aber sie kann auch eine hinterhältige kleine Schlange sein.
Als ich das erste Mal herkam, habe ich sofort gemerkt, dass Casey wusste, wer ich bin. Ihr Ausdruck in den Augen hat sie verraten. Trotzdem verlor sie kein Ton darüber, servierte mir Kaffee und stellte mir eine Keramikschüssel mit Keksen auf den Tisch.
Heute ist es dasselbe.
Ohne ein Wort zu wechseln, schiebt sie mir eine dampfende Tasse vor die Nase. Dann dreht sie sich um, holt einen kleinen Bestellblock aus ihrer Tasche und nimmt die Bestellung eines hageren Mannes entgegen.
Aus meiner Jackentasche krame ich mein Notizbuch und meinen MP3-Player hervor. Den linken Kopfhörer stecke ich mir ins Ohr, den rechten lasse ich achtlos nach unten baumeln. Während ich auf den ersten Klang warte, blicke ich aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Seite. Draußen parkt ein schwarzer Camaro an einer Zapfsäule. Zwei Jugendliche verschwinden in der Tankstelle und nach ein paar Minuten kehren sie mit Bier und Chips-Packungen zurück. Jubelnd werden sie in Empfang genommen, bevor der Motor des Camaro wieder anspringt. Ein Hauch von Sehnsucht übermannt mich.
Wann habe ich zum letzten Mal etwas mit den Jungs unternommen?
Ich atme ein, atme leise aus.
Was habe ich erwartet? Ich selbst habe meine Freunde von mir weggestoßen. Sie wie Dreck behandelt. Und wofür?
›Hätte‹ ist ein grauenhaftes Wort. Hätte ich nur auf ihre Warnungen gehört. Hätte ich mir die Zeit genommen, rational über meine Entscheidungen nachzudenken. Hätte ich die Zeichen nicht ignoriert, dann hätte es dazu nicht kommen müssen.
Und trotzdem …
Trotz allem warten sie auf mich. Auf meinem Handy sammeln sich ihre Versuche, mir ihre Hand zu reichen. Ich weiß nicht, wieso ich ihnen nicht antworte. Noch weniger weiß ich, was ich mühsam in Worte fassen soll, damit etwas, irgendetwas, passiert.
Ich denke an das, was Dr. Thomson gesagt hat: Wovor rennst du weg?
Und ich denke, dass ich die Antwort darauf kenne, nur zu feige bin, ihr ins Gesicht zu blicken.
Frustriert lehne ich mich zurück. Es fällt mir schwer, meine Gedanken in das Notizbuch niederzuschreiben.
Vielleicht ist es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, versuche ich mir einzureden.
Stattdessen greife ich nach meiner Tasse und genieße den nussigen Geschmack auf meiner Zunge.
»Hallo Ryan«, begrüßt mich eine gutgelaunte Stimme und als ich aufschaue, begegne ich Casey. Mit einer Hand langt sie über den Tisch und überprüft, ob die kleinen Behälter, in denen sich Kaffeesahne und Zuckerwürfel befinden, noch ausreichend gefüllt sind. Die vier schwarzen Sterne, die auf ihrem Handgelenk tätowiert sind, blitzen kurz unter ihrer langärmligen Bluse hervor.
»Hi Casey.«
Mein Zeigefinger tippt gegen die Tischplatte, im Einklang mit der ruhigen Melodie in meinem Ohr.
Casey dreht sich zu mir. »Hast du schon mal darüber nachgedacht, für eine Weile wegzugehen?«
Langsam sollten mich ihre sprunghaften Fragen nicht mehr verwundern, doch jedes Mal erwischt es mich eiskalt. Es scheint ihr sogar Spaß zu machen, wenn ich ihr schalkhaftes Grinsen richtig deute.
»Wovon weggehen?«, stelle ich mich dumm, obwohl mir bereits klar ist, worauf sie hinaus möchte.
»Von hier.«
Ja, hundert Punkte an mich.
»Nein, tu ich nicht.« Ich mache eine Pause, um eine sinnfreie Zeile, die lautet Glaubst du, Zeit wird deine Wunden heilen? zu schreiben, bevor ich sie durchstreiche. Wie dumm das klingt. Als ob dieser Satz irgendeine Bedeutung trägt. Zeit heilt keine Wunden. Wer auch immer diese Wörter aneinanderreihte, hatte keine Ahnung, dass weitaus mehr benötigt wird. Aber Hobbypsychologen verwenden diese Phrase wie das Aufkleben eines Pflasters. Im Grunde will man damit nur eines erreichen: Man will einen ruhig stellen. Egal, wo wir gerade im Leben stehen, wir verletzt oder verzweifelt genug sind, alles infrage zu stellen, es wird der eine Tag kommen, der uns retten wird. Ich entsinne mich an meine Antwort, die ich Dr. Thomson an den Kopf geknallt habe. Gerade amüsiert war er nicht, doch er ließ es mir durchgehen.
Ich nippe an meinen lauwarmen Kaffee und frage: »Warum sollte ich das wollen?«
»Es heißt Urlaub«, meint Casey. »Viele Leute machen es, um Abstand von all dem Drumherum zu bekommen. Weg vom Stress und den Erwartungen. Hab gehört, es soll sogar für jemanden wie dich gut sein.«
»Aha.« Ich gebe vor, darüber nachzudenken. Dann schüttele ich den Kopf mit einer gewissen Endgültigkeit. »Nein, nicht für mich. Aber danke für den Tipp.«
Doch Casey bleibt hartnäckig. »Dir geht es nicht gut. Du kannst die Sache nicht einfach ignorieren und hoffen, dass es sich von selbst löst. Abwechslung könnte dir wirklich helfen. Du verdienst eine Auszeit. Gibt es nicht ein Konzert, welches du dir unbedingt anhören willst? Einen Ort, wovon du schon immer geträumt hast hinzugehen? Oder ein Treffen mit ruppigen Schlägertypen und Rappern in einem Nachtclub? Trinken, Spaß haben, bezaubernde, halbnackte Ladys an Polstangen, ein paar Zeilen rappen? Komm schon, das klingt nach etwas, das dir gefallen könnte.«
Ich unterdrücke mir das Lachen. Ihre Fantasie ist beeindruckend. »Ich bin mir sicher, dass es Konzerte gibt, schöne Orte oder Kollegen, mit denen ich eine ausgelassene Party feiern könnte. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Es hätte nicht viel gefehlt und ich säße jetzt nicht hier.«
»Willst du damit andeuten, dass es eine Art Bestrafung für dich ist?«
Darauf erwidere ich nichts. Casey seufzt. Ein langes, frustriertes Pfeifen, aber auch ihr ist klar, wann ein Gespräch mit mir zu Ende ist. Ich habe geglaubt, dass das Thema damit durch wäre. Doch wie gesagt: hinterhältige kleine Schlange.
Denn in den nächsten Tagen finde ich auf dem Tisch, an dem ich immer sitze, verschiedene Flyer: Traumreise nach Vegas! Kreuzfahrt zu den Bahamas! Wandern auf den beliebtesten Pfadwegen! Alle Informationen über bevorstehende Konzerte in deiner Nähe!
Broschüren, die alles beinhalten, um eine Weile aus der Stadt zu kommen. Mit detaillierten Beschreibungen über das Angebot, Reisedaten und Preislisten. Alles direkt in meinen Händen. Ich könnte irgendwo hinreisen und vielleicht jemanden kennenlernen für eine superlustige Zeit und mich ins große Unbekannte stürzen.
Jedes Mal tauchen auf magische Weise neue Flyer auf und jedes Mal verspüre ich den innigen Drang, Casey für ihre Bemühungen anzubrüllen. Ich könnte mich einfach an einen anderen Tisch setzen, doch kaum überfällt mich dieser Gedanke, laufen meine Füße von allein in die hinterste Fensterreihe mit dem Blick auf die Tankstelle. Als mache es mir Spaß, mich selbst zu foltern, sehe ich mir die Broschüren tatsächlich an. Sie wecken vergessene Träume und Wünsche, von denen ich weiß, dass eine kleine Reise sie niemals erfüllen könnte.
Es ist lächerlich. Total bescheuert. Ein paar Wochen aus der Stadt werden mir nicht helfen, mein Leben auf die richtige Bahn zu lenken.
Mürrisch sammle ich meine Sachen zusammen. Dabei starre ich kurz auf meinem Block, den noch immer blanke Seiten füllen, bevor ich aus der Hosentasche ein paar Dollar fische und sie auf den Tisch lege. Das vertraute Glöckchen klingelt über mir und entlässt mich in die frische Januarluft.
Ich nehme den Bus zu meinem Apartment. Damals hatte ich ein unsicheres Gefühl, mir eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ich hätte so viel mit meinen Auftritten erreichen können. Ein schickes Auto. Markenklamotten. Die allerbesten Nahrungsmittel für meine Familie oder den besten Alkohol konsumieren können, doch ich wollte etwas Eigenes besitzen. Die Rückkehr in mein Elternhaus war unmöglich, zurück in die Wohnung meines Vaters ausgeschlossen und der Wohnwagen meines Onkels ist zwar praktisch, aber nicht gerade beeindruckend.
Jetzt bin ich froh über meine Entscheidung. Ich habe ein Zuhause, zu dem ich jederzeit zurückkehren kann. Egal, ob als erfolgreicher Rapper oder als vorbestrafter Arbeitsloser in einem System, welches mir nur minimale Chancen bietet.
Gähnend hole ich meinen Wohnungsschlüssel aus der Jackentasche und schließe die Tür auf. Blind taste ich nach dem Lichtschalter. Die Strahler an der Zimmerdecke fluten den Raum mit warmem Licht.
Achtlos streife ich die Schuhe ab und werfe meine Lederjacke in irgendeine Ecke. Neben dem Sideboard hängt ein schmaler Wandspiegel, doch allein aus Protest an die Worte von Dr. Thomson schaue ich nicht hinein.
Meine Wohnung befindet sich direkt unter dem Dach, zwei Zimmer, offene Wohnküche und Bad.
Das Hochhaus ist renoviert und die Gegend familienorientiert. Das Viertel liegt im nordwestlichen Teil unserer bescheidenen Kleinstadt. Es grenzt an die Stadthäuser hinter der Brücke und ist nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Ursprünglich war es ein Arbeiterviertel mit vielen kleinen Wohnungen, doch der Bürgermeister entschied sich, zu investieren. Nicht in den Ausbau der Innenstadt oder eine verbesserte Infrastruktur, sondern für ein Luxusviertel mit hochwertigem Wohnraum. Dass sich die meisten Bewohner diese Mieten niemals leisten können, schien ihn nicht ansatzweise zu interessieren. Genauso wenig, dass viele gezwungen waren, ihre Wohnungen zu verlassen.
Ich trete an die Stereoanlage und drehe den Schalter um. Leise, wohltemperierte Klaviertöne sickern heraus. Für einen Moment schließe ich die Augen, lasse die Musik über meine Ohren bis zu meinem Herzen eindringen.
Mit einem Glas Scotch in der Hand schiebe ich die Balkontür auf.
Jeden Abend sitze ich hier vor dem Schlafengehen und rauche eine Zigarette. Mein Blick wandert zu den Sternen, allerdings kann ich die Aussicht auf ihre kleinen Lichtkörper nicht länger als ein paar Sekunden ertragen.
Schwerfällig lasse ich mich auf den Klappstuhl fallen und kippe die braune Flüssigkeit in einem Schluck hinunter.
Was empfindest du, wenn du dich im Spiegel siehst? Welche Gedanken halten dich wach?
Meine Augen landen unfreiwillig auf dem kleinen Notizbuch, welches neben einer angefangenen Zigarettenpackung liegt. Wahllos schlage ich eine leere Seite auf.
Notizen aus Ryan Hales Journal (hellblau, 100 Seiten, spiralgebunden):
Da ist eine Bleistiftlinie durch den letzten Punkt gezogen. So stark, dass die Seite durchgerissen ist.