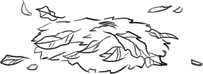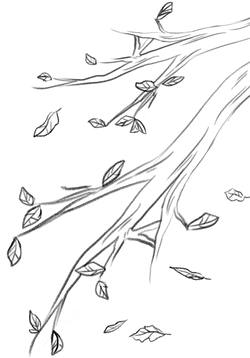
Die Stadt bei Nacht ist ein vollkommen anderes Erlebnis als am Tag. Sanftes Licht der Straßenbeleuchtung durchdringt die schmalen Gassen, erlaubt ein Gefühl von Sicherheit und Wärme.
Ich sitze abseits auf einer Bank. Niemand schenkt mir Beachtung. Seit über einer Stunde lausche ich den wummernden Bässen und starre auf die Menschenmenge, die sich vor dem bulligen Türsteher versammelt hat.
Willkommen im Liberty.
Dem besten Nachtclub unserer bescheidenen Kleinstadt.
Der Andrang ist groß. Feiern im gehobenen Stil, heißt es. Wer drin ist, gehört dazu. So wie mein Bruder Ryan und seine Freunde, die ihn tatkräftig anfeuern wollen, wenn er auf der Bühne ein paar Zeilen rappt.
Ich sollte reingehen und dasselbe tun. Über Wochen hat er den Inhaber angefleht, dass wir Zutritt bekommen – schließlich ist ein Teil seines Freundeskreises noch minderjährig. Aber ich kann mich nicht überwinden. Bei der bloßen Vorstellung, zwischen all den tanzenden Leibern zu sein, krampft sich mein Magen zusammen.
Abschätzig schaue ich auf den Vorplatz und beobachte die Menge. Die kichernden Mädchen vor dem Eingang, die mit ihrem Geschnatter die gesamte Straße unterhalten. Die verschwitzten Körper, die sich aus dem Club drängen, um eine zu rauchen, und dabei gut gelaunt zu dem poppigen Beat wippen, oder die Gruppe von Jungen, die ihre Nase gelangweilt in ihre Handys stecken.
Ich frage mich, was diese Menschen hinter ihren Fassaden verbergen. Es braucht nicht viel, um ihre Persönlichkeit grob zu erahnen. Da sind Muster in ihrem Verhalten, die sich wie ein Algorithmus ständig wiederholen.
Nehmen wir den Jungen, der neben einem protzigen Typen steht und den Kopf schüchtern gesenkt hält. Seitdem ich hier sitze, hat er sich kein einziges Mal an dem Gespräch beteiligt. Er macht sich klein, geht völlig unter und wird von den anderen überhaupt nicht wahrgenommen.
Ich stelle mir vor, dass er auch auf der Flucht ist, zum Beispiel vor den endlosen Stunden, die er hinter seinem Schreibtisch verbringen muss, angekettet und dazu verdammt, den Anweisungen seines Arbeitgebers stupide zu folgen, und damit ein Glied in der perfekten Gesellschaft spiegelt.
Irritiert runzle ich die Stirn.
Wer definiert, was perfekt ist? Ich? Die Leute im Club?
Egal wer, es ist verrückt. Nichts ist makellos. Hinter jedem steckt eine gut behütete Lüge, ein Schleier vor dem glücklichen Bild, das wir nach außen transportieren.
Plötzlich durchschneidet ein Scheppern meine Gedankenbahnen. Vor mir torkeln vier Mädchen in knappen Kleidern und jammern einer zerbrochenen Flasche nach.
»Du bist so ungeschickt!«, tadelt eine von ihnen.
Das Mädchen neben ihr verzieht das Gesicht. »War keine Absicht.«
»Da geht er hin, der gute Alkohol.«
»Im Club gibt’s mehr«, lacht die Vierte.
Mein Herz stolpert, als ich sie sehe. Das zuckende Licht eines vorbeifahrenden Autos offenbart mir ihr Gesicht. Ich kenne sie. Ashley Shawn. Ein hübscher Name für ein hübsches Mädchen. Schöne lockige Haare. Ein freundliches Lächeln. Markenklamotten und Anführerin der Cheerleadermannschaft unserer Schule. Jeder meint, dass sie nett ist und zu den beliebtesten Schülerinnen gehört. Denn sie ist süß und kommt mit allen gut zurecht. Ein Vorbild eben.
Ich kann sie nicht ausstehen.
Und das hat mehrere Gründe, obwohl nur ein einziger sich tief in mein Herz bohrt.
Sie pustet den blaugrauen Rauch aus und schnipst den Zigarettenstummel auf den Boden, bevor sie mit ihren Freundinnen in den Club geht.
Ihr Verhalten stößt mir übel auf. Ich mag mir nicht vorstellen, was sie hinter den Türen treibt. Deshalb schlage ich die Kapuze meines Hoodies hoch und verlasse den Platz mit zügigen Schritten.
Sofort fühle ich mich wie ein Arsch. Ein weinerliches Arschloch. Nicht einmal einen Clubbesuch kann ich durchstehen, ohne den Schwanz einzuziehen. Ich werde nie verstehen, was meine Freunde in mir sehen.
Die Hände tief in den Taschen meiner Jacke vergraben, umfassen meine Finger den Schlüssel. Soll ich nach Hause gehen? Mir würde wahrscheinlich eine vernünftige Entschuldigung einfallen, weshalb ich Ryans Auftritt verpasst habe. Vielleicht könnte ich behaupten, dass ich schlichtweg zu müde war oder einen Aufsatz für die Schule zu schreiben hätte, an den ich mich gerade erst erinnert hatte. Aber mein Bruder würde mir das nicht glauben. Er weiß, dass ich meine Schularbeiten gewissenhaft an dem Abend erledige, nachdem sie uns zugewiesen wurden.
Ich bin wirklich ein mieses kleines Arschloch. Ich schäme mich. Für so viele Dinge, aber am meisten dafür, wie leicht es mir fällt, eine zurechtgelegte Lüge zu formen.
Eine Vibration zuckt durch meine Jackentasche und ich kicke eine Dose, die einsam und vergessen auf dem Bordstein liegen gelassen wurde, gegen die Mauer eines Wohnhauses. Aus der Seitengasse hechtet eine Katze hervor und ihre Augen reflektieren die Lichter der Straßenlaternen. Sie verharrt auf dem Gehweg, die Ohren aufgestellt. Die Dose muss sie erschreckt haben. Ihr leises Miauen lässt mich beinahe zusammenbrechen.
Ich hasse es. Alles, was sich falsch anfühlt. Die leeren Gesichter, die müden Augen, den Albtraum, der sich tag-täglich zu Hause wiederholt. Schon länger habe ich das Gefühl, dass etwas zerreißt. Ich kann es nur nicht benennen, traue mich nicht, dem einen Namen zu geben. Aus Sorge, es könnte wahr sein.
Ich weiß nicht, wie lange ich durch die Nachbarschaft gelaufen bin. Eine halbe Stunde? Vielleicht auch länger.
Ein Lachen entweicht meiner Kehle, als ich realisiere, wohin meine Beine mich getragen haben.
Das Festivalgelände. Geschäft an Geschäft reiht sich vor mir der Jahrmarkt auf. In der Mitte erhebt sich ein riesiges Rad, an dem in regelmäßigen Abständen rote Gondeln hängen.
Es ist … perfekt.
Kurz schaue ich mich um, vergewissere mich, dass niemand mein Vorhaben beobachtet, und hieve mich dann über den Maschendrahtzaun. Mit vorsichtigen Schritten komme ich dem Ziel meiner Begierde näher. Es ist groß – größer, als ich dachte.
Beim näheren Betrachten der Verstrebungen des Riesenrads entdecke ich eine Sprossenleiter.
Mein Herz klopft schneller. Es ist verrückt. Ein einziger Fehlgriff und mein Leben schwindet in Sekunden. Trotzdem kann ich der Vernunft, wieder herunterzusteigen, nicht nachgeben. Ich wage einen Blick nach unten auf das Steinpflaster. Hitze steigt mir ins Gesicht und ich merke, dass meine Finger zittrig werden.
Die Höhe reicht noch nicht, rufe ich mir zu.
Sprosse um Sprosse klettere ich weiter, bis zu einer Plattform unterhalb der Radnabe. Ein Meer aus schwarzen Blöcken hebt sich hervor, die vom Licht der Straßenbeleuchtung abgetrennt werden. Alles wirkt so winzig, so weit entfernt.
Der Wind bläst stärker und mein Atem bildet kleine weiße Wölkchen. Ich fröstele, aber der Ausblick ist wunderschön. Sofort greife ich nach der Kamera, die um meinen Hals hängt, und blicke auf. Über mir spannt sich ein unglaublich klarer Nachthimmel.
In der Ferne ertönt eine Sirene. Ich verdränge es, achte nur auf die Lichter.
Tausende kleine Lichtkörper, die auf mich herabblicken, und ich glaube, in ihnen Mom zu sehen. Ihr breites Lächeln und das vertraute Funkeln in ihren Augen.
Du bist etwas Besonderes, höre ich ihre samtweiche Stimme in meinem Ohr.
Ein Strick legt sich um meinen Hals.
Bin ich das?
Warum fühle ich das, was kein anderer fühlt?
Warum höre ich das, was kein anderer hört?
Warum sehe ich das, was kein anderer sieht?
Es ist wie ein Gefängnis. Eingesperrt und in Ketten, machtlos, irgendetwas dagegen zu tun.
Ein Windstoß lässt den Stoff meiner Sachen flattern. Unbeeindruckt richte ich die Kamera aus, setze meinen Fokus und drücke den Auslöser. Die Belichtung dauert einige Sekunden. Zufrieden betrachte ich das Foto, das mir Millionen von Sternen offenbart. Alles um mich herum kommt zum Stillstand und ich denke, dass es in Ordnung ist.
Die Last, der Schmerz, die Verwirrung.
Denn ich liebe diesen Ort. Die glühende Sonne bei Tag, den sandigen Boden unter meinen Füßen, wenn ich den Strand entlanglaufe, das sanfte, doch stürmische Rauschen des Wassers und die schier endlose Ruhe am Rande der Stadt, nachdem die Uhr zwölf geschlagen hat.
Ich finde jeden Tag Gründe, mich neu zu verlieben, und heute Nacht ist es dasselbe. Und vielleicht, ja vielleicht, genügt das.
Hier bin ich wieder ich selbst. Mehr brauche ich nicht. Weit oben, den Sternen zum Greifen nahe, weit weg von den Menschenmassen und den lauten Geräuschen.
Erneut lausche ich den Sirenen und sehe unter mir ein Meer aus Rot und Blau. Ich tapse an den Rand der Plattform und breite die Arme aus. Die eisige Aprilluft umspielt meine Finger. Ein letztes Mal sauge ich den atemberaubenden Ausblick in mich ein, bevor ich die Augen schließe und mir in meinen Gedanken vorstelle, wie ich mich fallen lasse.
»Hey!«
Schlagartig werde ich wach und fühle mich, als hätte mir jemand einen Eimer Eiswasser über den Kopf geschüttet. Verwirrt blinzle ich. Einmal, zweimal.
Etliche Sekunden verstreichen, ehe ich meine Umgebung wahrnehme. Ich bin in einem kleinen Raum ohne Fenster, ein Tisch, zwei Klappstühle und ein Mann in der Uniform der örtlichen Polizeistation.
Dunkle Augen halten mich fest.
»Hast du mir zugehört?«, fragt der Beamte grimmig.
Ich ziehe es vor, zu schweigen. Meine Gedanken sind ein reines Durcheinander. Bis eben glaubte ich, weit oben auf dem Riesenrad zu stehen und in dem Anblick der Sterne zu ertrinken, doch nun sitze ich auf einem unbequemen Stuhl in einem stickigen Verhörraum. Ich grummle einen Fluch, als mir bewusst wird, was passiert ist.
Jemand hat die Polizei gerufen.
Ich wurde erwischt.
Schon wieder.
»Was hast du dir dabei gedacht, auf ein verdammtes Riesenrad zu klettern?! Das hätte üble Folgen für dich haben können!«
Der Polizist ist mir unbekannt und scheint älter, als ich anfänglich vermutet habe. Mitte vierzig, vielleicht auch fünfzig, graues Haar, runder Bauch, tief liegende Augen und faltige Haut.
Ich habe keine Lust, darüber zu diskutieren. Soll ich um Verzeihung bitten? Die Tat begründen? Er würde mich nicht verstehen. Zu schnell ein Urteil fällen und mir einen Stempel aufdrücken, wie es alle Erwachsenen tun. Deshalb verharre ich in Schweigen. Seinem verdatterten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ist es wohl nicht die richtige Entscheidung gewesen.
»Ich rede mit dir!«, brüllt er und stützt sich auf den Tisch, um sich vorzulehnen. Die Ader an seinem Hals pulsiert kräftig. Langsam setzt er sich wieder hin und atmet tief durch. »Hör zu. Ich will es verstehen und dir helfen. Wie ist dein Name, Jüngchen?«
Darauf zucke ich nur die Schultern. »Darf ich jemanden anrufen?«, frage ich tonlos.
»Nicht bevor du mir deinen Namen verraten hast. Wir werden deine Eltern kontaktieren müssen.«
Eltern. Das Wort hinterlässt einen komischen Beigeschmack in meinem Mund.
»Dad.«
»Wie bitte?«
»Sie werden meinen Dad kontaktieren«, korrigiere ich ihn.
Genervt von meiner Aussage, schiebt er mir Zettel und Stift entgegen. »Name und Nummer deines Dads.«
Ich betrachte das blanke Papier. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, seinem Willen zu folgen, aber ich weiß, was dann passiert. Dad ist mit unserer Lage maßlos überfordert. Einen Sohn wie mich braucht er nicht. Er würde nicht kommen, selbst wenn er von der Polizei höchstpersönlich beordert wird.
»Ich warte«, drängt der Beamte und trommelt ungeduldig mit den Fingerspitzen auf der Tischplatte.
Ich beiße mir auf die Unterlippe. Meine Kehle schnürt sich zu, mein Puls wird schneller. In Gedanken beginne ich zu zählen.
Eins, zwei, drei, vier …
Ich halte die Luft an.
… fünf, sechs, sieben.
Unerwartet öffnet sich die Tür und ich atme zittrig aus. Sheriff David Jensen betritt ein wenig außer Puste den Verhörraum. So als hätte er es besonders eilig gehabt, das Gespräch zu unterbrechen. Unsere Blicke kreuzen sich und so etwas wie Scham steigt in meiner Brust auf.
»Was ist hier los?«, fragt Jensen und greift nach der Akte, die der grimmige Beamte ihm entgegenhält. Sorgsam liest er die Zeilen, die Anspannung in seinen Mundwinkeln deutlich erkennbar. »Ich kümmere mich darum«, fährt er mit einem lang gezogenen Seufzer fort. Zeitgleich kritzelt er etwas auf ein leeres Blatt Papier. »Vance, ruf diese Nummer an und bitte ihn, herzukommen«, wendet er sich an seinen Kollegen.
Fassungslos starrt dieser ihn an. »Das meinen Sie doch nicht –« Er hält sich zurück. Abwechselnd sieht er zwischen mir und seinem Chef hin und her. Seine Miene verzieht sich. »Wie Sie wünschen«, raunt Vance und reißt Jensen den Zettel aus der Hand.
Die Tür fällt laut ins Schloss.
Ein leises Lachen entfährt Jensen. Er ist jung, Ende dreißig, schmal, dennoch sehr muskulös. In der Stadt genießt er Respekt und ein gewisses Ansehen. Nur wenige Mäuler meinen, er sei für den Posten als Sheriff ungeeignet. Zu naiv. Zu nachsichtig. Zu freundlich. Unfreiwillig saß ich ihm schon mehrmals gegenüber. Sobald jemand die Polizei ruft und ich in Blaulicht abgeführt werde, dauert es nicht lange und Jensen übernimmt das Gespräch. In letzter Zeit scheine ich die Aufmerksamkeit der besorgten Beamten magisch anzuziehen. Sie wissen, wo ich mich herumtreibe, was ich mache und dass ich angeblich andere mit meinem Verhalten in Gefahr bringe.
»Also«, beginnt Jensen. »Was war dieses Mal der Auslöser? Streit mit Klassenkameraden? Ärger zu Hause? Drogen? Alkohol?«
Ich versuche, nicht laut aufzustöhnen, als er diese Worte wählt. Es klingt wie aus einem Katalog für aufmüpfige, schwererziehbare Kinder.
Bin ich ein Problemkind?
Vermutlich kann man das durchaus so sagen.
Ich habe das Gefühl, dass mich niemand wirklich versteht. Die Erwachsenen reden, die Lehrer ignorieren und meine Mitschüler ziehen mich auf. Meinen Standpunkt zu beweisen, führt zu keiner Lösung. Ich könnte so viele Dinge aufzählen. Dinge erläutern, die mich in ein anderes Licht rücken. Doch wozu die Mühe? Die Menschen um mich herum urteilen, ohne nachzufragen. Ich habe gelernt, es zu akzeptieren. Und es funktioniert. So richtig schlimm wurde alles erst, nachdem meine Mom den Kampf gegen ihre Krankheit verloren hatte. Sie ist fort. Für immer …
»Über was denkst du nach?«, fragt Jensen sacht. »Ich bin hier. Rede mit mir, Philip.«
Mit einem Schulterzucken breche ich den Blickkontakt.
»Mal wieder sehr gesprächig, was?« Eine Pause. »Willst du was trinken?«
Die Frage ist neu.
»Warum?«, brumme ich misstrauisch.
»Dachte, du könntest durstig sein«, antwortet Jensen und macht sich an der Kaffeemaschine zu schaffen, die in einer Ecke des Raumes steht. Fragend schaut er mich an, wartet auf eine Reaktion. Ich verneine. Mit einem dampfenden Becher kehrt er zurück.
»Warst du im Liberty?«
»Woher –«, setze ich an, breche jedoch ab, als ich meinen Fehler bemerke.
Jensen nippt an seinem Kaffee. »Du stinkst nach Alkohol und Rauch. Hast du –«
»Ich habe nicht getrunken«, schneide ich ihn.
»Gut.«
Wieder wird es still. Von irgendwo höre ich ein monotones Ticken. Ohne es richtig zu merken, beginne ich, mit den Beinen zu zappeln. Das Geräusch wird lauter. Es ist nervtötend.
»Was ist los?«
Ich starre auf seine silberne Armbanduhr. »Wann darf ich gehen?«
»Du weißt, dass ich dich dieses Mal nicht so einfach gehen lassen kann.«
»Warum nicht?«
»Ich kann deine – eure – Situation nicht länger unter den Tisch kehren. Die Leute reden. Über deinen Vater, über Ryan und auch über dich. Ich will euch beschützen, aber das kann ich nicht, solange du mir nicht erzählst, was los ist. «
Ich mag Jensen. Er ist immer nett zu uns. Ob es daran liegt, dass ich mit seinem Sohn Edward befreundet bin, weiß ich nicht, doch seit Moms Tod kümmert er sich um uns. Ich bin ihm dankbar, allerdings brauchen wir seine Hilfe nicht. Uns geht es gut. Wir tun das, worin wir am besten sind. Wir lassen die Leute reden, ignorieren ihre Blicke, die Finger, die auf uns gerichtet sind, und die tuschelnden Worte, die nichts als Lügen erzählen. Wenn man unsere Nachbarn ausfragt, wird uns hinterher gesagt, dass wir eine zerrüttete Familie seien. Mein Bruder sei nach dem Tod unserer Mom durchgedreht. Schulabbruch. Launisch. Ein Einzelkämpfer. Ryan lebt allein in einem alten Wohnwagen und es wird behauptet, dass er ein gewalttätiger Verbrecher sei.
Alles Lügen!
Mein Bruder war der Einzige, der nach unserem Verlust ruhig geblieben ist und versucht hat, die Rolle unserer Eltern zu verkörpern. Er suchte sich Arbeit, statt zu studieren. Zahlt einen Teil der Miete und kümmert sich ums Essen, wenn das Geld am Ende des Monats knapp wird. Auf Dad können wir uns kaum noch verlassen. Er hängt den ganzen Tag in seinem Sessel, Bier und Kippe in der Hand, und schaut irgendwelche Sportshows im Fernsehen. Ich verstehe, dass er leidet. Er kämpft, genauso wie wir. Nur eben auf eine andere Art und Weise.
»Philip?«
Ich sehe auf. »Mir fehlt nichts.«
»Warum bringst du dich ständig in Gefahr?«
»Tue ich nicht«, streite ich ab.
»Also willst du mir erklären, dass das völlig normal ist?«, fragt Jensen mit hochgezogener Augenbraue. »Wenn du das glaubst, ist es schlimmer, als ich befürchtet habe.«
Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht.
»Was meinen Sie?«
»Es –«
Ein Klopfen an der Tür unterbricht ihn. »Sir? Ryan Hale ist da und möchte mit Ihnen sprechen.«
Jensen sieht mich prüfend an, bevor er seine Tasse abstellt und den Raum verlässt.
Da fällt mir ein, dass mein Handy auf dem Weg zum Festivalgelände vibriert hat. Ich hole es aus der Jackentasche und öffne die Nachricht. Drei Worte, geschrieben von meinem besten Freund.
Colin
Wo bleibst du?
Zusammengesunken denke ich nach. Ich erwäge, Colin zu schreiben, um ihn zu fragen, ob wir uns morgen treffen können, damit ich endlich über alles reden kann, was mich bedrückt. Ich überlege, Evan anzurufen, um ihn nach Rat zu fragen. Und ich denke darüber nach, was das alles eigentlich bringen soll. Sie alle haben ihre eigenen Probleme. Ich will niemandem eine Last sein. Schon gar nicht Ryan.
Ich weiß, dass mein Bruder wahnsinnig enttäuscht ist. Nicht zum ersten Mal muss er mich von der Polizeidienst-stelle abholen und sich vor Jensen erklären. Dabei ist es das Letzte, was ich will.
Bist du dir sicher?, freut sich eine Stimme in meinen Gedanken hämisch und ich springe auf. In zwei, drei schnellen Schritten lasse ich sie und dieses Zimmer hinter mir und spähe in einen langen Gang.
Die Lichter der Nacht treffen auf trostlose Leere. Nur grau in grau, unterbrochen vom schwachen Schein der Laternen. Beim Vorbeigehen entlang der Fensterfront entdecke ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Hauswand, die mit Graffiti vollgesaut ist. Nichts von kreativem Wert oder sonstiger Schönheit. Belanglose Schmierereien und Gang-Tags verunstalten das schöne historische Geschäftsgebäude. Ich frage mich, was manche Menschen damit bezwecken wollen. Ist das ihr vergeblicher Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit oder einfach nur ein Kick, um ihr Leben ein bisschen spannender zu gestalten?
Müde tragen meine Füße mich voran. Vereinzelt stecken Beamte hinter ihren Schreibtischen fest und erledigen Schreibarbeiten. Zwischen zwei Reihen finde ich meinen Bruder. Mit störrischer Miene lässt er die Worte von Jensen über sich ergehen.
Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich. Ryan ist größer, mit kräftigen Oberarmen, und im Gegensatz zu mir hat er blondes Haar. Wir kleiden uns auch anders. Während ich dunkle Sachen bevorzuge, meist eine alte Jeans, einen schwarzen Pulli und einfache Turnschuhe, trägt Ryan helle, farbenfrohe Klamotten.
»Ryan, ich weiß, du bist gut mit Edward befreundet und ihr sorgt euch um Philip, aber das kann ich nicht verantworten.«
»Das ist bestimmt nur ein Missverständnis«, versucht Ryan, zu beschwichtigen.
»Wohnhausdächer, unbewachtes Baustellengelände und nun ein Riesenrad. Das geht zu weit. Schon mal darüber nachgedacht, dass er seine überschüssige Energie in Schulaktivitäten ausleben sollte oder ihm professionelle Hilfe zu suchen?«
»Verzeihung?«, knurrt Ryan aus zusammengepressten Lippen.
»Ich habe einen Eid geschworen«, meint Jensen auf einmal ernst. »Und ich habe nicht vor, ihn zu brechen.«
Mein Bruder schüttelt den Kopf. »Ich werde die Strafe bezahlen und mich, wenn verlangt, öffentlich entschuldigen, nur bitte sehen Sie von einer Meldung ab. Wir haben schon genug Probleme.«
»Sie tun nur ihre Arbeit.«
»Schließt das penetrante Fragen und haltlose Unterstellungen mit ein?«
Jensen wirft die Akte beiseite. »Was erwartest du von mir? So etwas kann ich nicht kommentarlos ignorieren.«
»Es wird nicht noch einmal vorkommen.«
»Zu oft hast du mir dieses Versprechen gegeben und zu oft wurde es gebrochen. Mensch, Ryan, ich will euch beschützen.«
»Vor was?«, schreit er. »Uns geht es gut.«
»Dann nenn mir den Grund.«
Ryan öffnet und schließt seinen Mund ein paarmal. Er kann es ihm nicht sagen, denn er hat keine Ahnung, was in mir vorgeht. Ich verstehe es selbst nicht. Ich will niemandem schaden und trotzdem habe ich das bedrückende Gefühl, genau das zu tun.
»Dachte ich es mir«, murmelt Jensen und will sich abwenden, als ich beschließe, nach ihm zu rufen. Kaum nimmt Ryan meine Anwesenheit wahr, drängt er sich an Jensen vorbei, um vor mir stehen zu bleiben und nach meinen Oberarmen zu greifen. Ruppig schüttelt er mich.
»Was hast du dir nur dabei gedacht?«, keift er aufgebracht. »Wie oft muss ich dir sagen, dass du dich zusammenreißen sollst?! Dir hätte –«
»Ich –«
»Nein, verdammt! Ich will keine scheiß Ausrede hören!«
Die Lippen zu einer schmalen Linie gezogen, gehorche ich.
»Es tut mir leid«, bittet Ryan an Jensen gerichtet. »Nennen Sie mir die Höhe der Strafe und ich begleiche die Schuld, nur bitte halten Sie das Jugendamt da raus.«
Jensen sieht auf die Akte, dann reibt er sich über die Stirn, so als hätte er Kopfschmerzen. »Also gut«, gibt er nach. »Aber das ist das allerletzte Mal. Noch so ein Vorfall und ich werde es melden.«
»Ich danke Ihnen.«
»Passt besser aufeinander auf«, seufzt Jensen entkräftet. »Ich will ungern euren Vater damit belasten.«
Hellhörig horche ich auf. Es erstaunt mich, dass ich nicht viel eher danach gefragt habe.
»Warum haben Sie eigentlich meinen Bruder rufen lassen?«
»Ich will euch nichts Böses, Philip.«
Damit sucht er seine Unterlagen auf dem Tisch zusammen und kehrt uns den Rücken zu. Ich sehe ihm nach, bis er hinter seiner Bürotür verschwindet, und bemerke dann, dass der Beamte von vorhin mich nicht aus den Augen lässt. Wut verzerrt sein Gesicht. Er hat wohl mit etwas anderem als mit einer schlichten Verwarnung gerechnet.
»Irgendwann wird dich keiner mehr vor deiner Fahrlässigkeit schützen können«, schimpft er und stampft in den Flur zu den Verhörräumen zurück.
Es dauert, bis seine Worte bei mir ankommen.
Allein.
Niemand, der mich schützen wird.
Daran will ich nicht denken.
Ryan zieht mich Richtung Ausgang. »Das war das zweite Mal diese Woche. Was geht nur in deinem Kopf vor?! Du hast gewusst, dass ich heute einen Auftritt habe, aber nein, Mr. Mir-geht-es-blendend-ich-liebe-die-Gefahr-und-Höhen denkt nicht nach und versetzt die Polizei in den Glauben, dass er sich von einem Riesenrad stürzen will!«
Panik umfängt mich. Der Kloß in meinem Hals drückt mir die Luft ab.
»Ich wollte nicht springen«, beteuere ich. Und das ist die Wahrheit, deswegen sage ich es noch mal.
»Was hattest du dort oben zu suchen?«, fragt Ryan.
»Ich wollte …«, versuche ich, zu erklären, und stolpere.
Er wird dir nicht glauben, kehrt die Stimme in meinen Gedanken zurück. Sie lacht amüsiert. Denkt, du wärst schwach. Selbstmordgefährdet!
»Das stimmt nicht!«, schreie ich und sämtliche Gespräche verstummen. Die Spitzen meiner Ohren glühen. Beschämt senke ich mein Kinn. »Kannst du mich bitte nach Hause fahren?«
»Philip …«
Sein Ton trieft vor Sorge und seine Augen wandern auf mein Handgelenk. Sofort entziehe ich mich seinem Blick, indem ich mich abwende. Es tut weh. Der Knoten, der sich um meinen Hals schnürt.
Mit einem Ruck schiebe ich die Tür auf und eile die Treppenstufen nach unten. Auf dem Bürgersteig bleibe ich stehen, fülle meine Lungen mit der frischen Nachtluft.
»Alles okay?«, hinterfragt Ryan und hält Abstand.
»Ja«, antworte ich gepresst.
»Kannst du mir endlich erklären, was dich geritten hat, auf ein gottverdammtes Riesenrad zu klettern?«
Ich balle die Hände, so fest, dass sich meine Nägel in die Haut bohren. »Ich wollte meine Ruhe haben.«
»Und deswegen bringst du dich in Gefahr?«
Energisch verneine ich. »Ich hatte nicht vor … ich meine … ich weiß, dass es gefährlich ist, aber … aber es erinnert mich an Mom.« Die letzten Worte schreie ich heraus. Tränen schießen mir in die Augen. Ich schlucke schwer und beiße mir auf die Seiten meiner Zunge, um sie zurückzuhalten. »Sie hat die Sterne geliebt, sie gemeinsam mit mir bewundert und mir Geschichten darüber erzählt. Ich habe das Gefühl, nur in ihrer Nähe wieder ich selbst zu sein.«
Stumm rollen die Tränen nun von meinen Wangen. Frustriert wische ich sie mit den Ärmeln meiner Jacke weg.
»Es tut mir leid«, schniefe ich. »Ich wollte deinen Auftritt nicht verderben oder jemandem Sorgen bereiten. Ich wollte nur … ich wollte nur …«
»Schhh«, wispert Ryan und ich spüre seinen Atem auf meiner Haut, bevor er mich in seine Arme zieht. »Es ist okay.«
Er nimmt meine Hand in seine und führt mich in die entgegengesetzte Richtung. Nicht zum Wohngebiet, in die lauten, kalten vier Wände, die mein Zuhause geworden sind, sondern zum Strand.
Irritiert suche ich seinen Blick. »Wo gehen wir hin?«
»Du bleibst heute Nacht bei mir«, sagt er entscheidend. »Werde später mit Dad reden und ihm Bescheid geben.« Mit dem Finger deutet er auf meine Kamera, die um meinen Hals baumelt. »Zeig mir die Fotos, ja?«
Mir wird warm, wenn ich an die Bilder denke.
Lächelnd lasse ich mich führen, den Kopf im Nacken, hoch zum Sternenhimmel gerichtet.
Alles ist in Ordnung.
Ich wiederhole es. Immer und immer wieder.
Du bist naiv und feige, singt die grauenhafte Stimme. Glaubst, du kannst die Scherben zusammenfügen, die du hinterlässt. Schau dich um, Kleiner. Dein Haus aus Karten wird nicht ewig halten.
Eine Lüge!
Es wird nicht fallen. Mit jedem Tag wird das Gerüst größer und stärker. Ich bin in Sicherheit, so wie mein Bruder und unsere Freunde.
Die Stimme grunzt und verschwindet.
Ich halte Ryans Hand fester.
Ja, denke ich, mir geht es bestens.